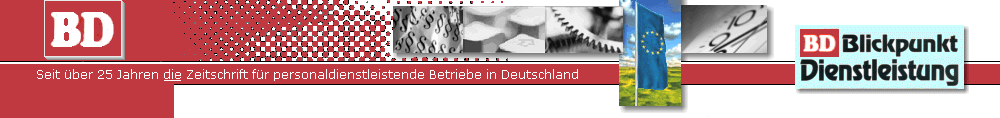|
Dr.
Alexander Bissels und Kira Falter
Wirksamkeit
einer Klausel zur Zahlung einer Vermittlungsprovision –
höchstrichterliche Klärung durch den BGH!
Wir
haben in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach darüber
berichtet, dass Meinungsverschiedenheiten über die Zahlung einer
Vermittlungsprovision durch den Kunden nach der Übernahme eines
Zeitarbeitnehmers in Zusammenhang mit einer Überlassung zuletzt
verstärkt die Zivilgerichte befasst haben (vgl. zuletzt noch: OLG
Celle v. 15.10.2020 – 11 U 5/20; dazu: Bissels/ Falter,
jurisPR-ArbR 50/2020 Anm. 7; Bissels/Falter, BD 10/2018, 3 ff.).
Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Nicht zuletzt
dürfte dabei auch der Fachkräftemangel und der gesetzgeberisch
intendierte "Übernahmedruck" durch die Ergänzung des
AÜG um eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten mit Wirkung
zum 01.04.2017 eine Rolle spielen. Das Zeitarbeitsunternehmen
verliert durch die Überführung des Mitarbeiters in ein
Arbeitsverhältnis zu dem Kunden ein für dessen Geschäftsmodell
wesentliches "Asset", das nicht ohne weiteres ersetzt
werden kann. Vor diesem Hintergrund wird erklärbar, dass bei
Zeitarbeitsunternehmen in der jüngeren Vergangenheit durchaus
eine höhere Bereitschaft zu wahrzunehmen ist, die vereinbarte
Gegenleistung für die Übernahme, nämlich die Zahlung einer
Vermittlungsprovision, gerichtlich durchzusetzen, wenn und soweit
der Kunde eine solche verweigert, und nicht "klein
beizugeben".
Streitig
war dabei zuletzt immer wieder die Frage, ob der Kunde eine
Vermittlungsprovision leisten muss, wenn das Arbeitsverhältnis zu
dem überlassenen Mitarbeiter von dem Zeitarbeitsunternehmen, z.B.
durch eine Kündigung, beendet wurde und selbiger nach einer
Anschlussbeschäftigung sucht, die er dann oftmals bei dem Kunden,
bei dem er eingesetzt war oder immer noch ist, findet. Die
Instanzrechtsprechung war in diesem Zusammenhang nicht
einheitlich. In einer aktuellen Entscheidung hat sich nun der BGH
dieser Frage angenommen und festgestellt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses durch das Zeitarbeitsunternehmen vor der
Übernahme durch den Kunden grundsätzlich der Entstehung eines
Anspruchs auf die Zahlung einer Vermittlungsprovision nicht
entgegensteht (vgl. BGH v. 05.11.2020 – III ZR 156/19;
vorgehend: LG Tübingen v. 25.10.2019 – 1 S 55/19; AG Tübingen
v. 26.04.2019 – 12 C 893/18).
I.
Zusammenfassung der Entscheidung
Am
30.10.2014 schloss die Beklagte mit der X GmbH (deren
Rechtsnachfolgerin ist die hiesige Klägerin), bei der es sich um
eine über eine unbefristete Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis
nach § 1 AÜG verfügende Personaldienstleisterin handelte, einen
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Dieser bezog sich auf die
Überlassung des Y an die Beklagte. In dem Vertrag findet sich
u.a. folgende Regelung:
"Endet
das Arbeitsverhältnis des überlassenen Mitarbeiters mit der X
und begründet dieser anschließend ein Arbeitsverhältnis mit dem
Kunden oder einem mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen, so ist dieses durch Vermittlung bzw.
Nachweis von X entstanden. Der Kunde verpflichtet sich in einem
solchen Fall, ein Vermittlungs- bzw. Nachweishonorar zu zahlen. Dieses
beträgt zwei Bruttomonatsgehälter und reduziert sich
entsprechend der Dauer der erfolgten Arbeitnehmerüberlassung für
jeden vollen Monat um ein Zwölftel.
(...)
Für
den Fall, dass zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses
und dem Ende der Überlassung eine Zeitspanne von maximal 6
Monaten liegt, wird vermutet, dass die Begründung des
Arbeitsverhältnisses auf die Überlassung zurückzuführen ist,
so dass der X das vorstehend vereinbarte Vermittlungs- bzw.
Nachweishonorar auch zusteht, soweit der Kunde oder das mit ihm
verbundene Unternehmen diese Vermutung nicht widerlegt. Diese
Vereinbarung endet nach neun Monaten nach Beginn des AÜV".
Y
wurde bis zum 31.12.2014 im Betrieb der Beklagten eingesetzt. Die
X GmbH beendete das Arbeitsverhältnis mit Y durch eine
betriebsbedingte Kündigung zum 23.02.2015. Am 06.03.2015
begründete die Beklagte ein Arbeitsverhältnis mit Y. Daraufhin
stellte die X GmbH der Beklagten ein Vermittlungs- bzw.
Nachweishonorar für Y in Höhe von 3.748,50 EUR in Rechnung. Die
Klägerin ist der Ansicht, ihr Anspruch auf Zahlung der
Vermittlungsvergütung ergebe sich aus dem
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag.
Das
Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat ihr
in Höhe von 3.402,75 EUR zzgl. Zinsen stattgegeben. Die hiergegen
von der Beklagten eingelegte Revision wurde vom BGH als
unbegründet zurückgewiesen. Das Berufungsgericht hat zur
Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt:
Die
Klausel zum Vermittlungshonorar, die nach ihrem Wortlaut den
hiesigen Fall erfasse, in dem der frühere Kunde nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zwischen dem Personaldienstleister und
dem Arbeitnehmer ein solches mit diesem begründet habe, sei
wirksam, insbesondere stehe ihr nicht die Regelung des § 9 Abs. 1
Nr. 3 HS. 2 AÜG entgegen. Der von der Beklagten angeführte
Umstand, dass das neue Arbeitsverhältnis zwischen Y und ihr erst
nach Kündigung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Personaldienstleister begründet worden und diesem daher kein
auszugleichender wirtschaftlicher Nachteil durch den Verlust eines
Arbeitnehmers entstanden sei, führe nicht zur Unwirksamkeit der
Klausel. Es gebe nämlich keine Anhaltspunkte dafür, dass der
Gesetzgeber die Zulässigkeit einer Vergütungsvereinbarung davon
habe abhängig machen wollen, ob und ggf. durch wen das
Arbeitsverhältnis zwischen dem Personaldienstleister und dem
Arbeitnehmer vor der Einstellung durch den Kunden beendet worden
sei. Ansonsten hätte in § 9 Abs. 1 Nr. 3 HS. 2 AÜG vorgesehen
werden müssen, dass eine Vermittlungsprovision ausgeschlossen
sein solle, wenn das Arbeitsverhältnis mit dem Zeitarbeitnehmer
durch den Personaldienstleister oder auf dessen Veranlassung
beendet worden sei. Da dies nicht geschehen sei, sei daraus – im
Umkehrschluss – abzuleiten, dass eine Arbeitgeberkündigung die
Zulässigkeit einer Vermittlungsprovision gerade nicht sperren
solle. Der Personaldienstleister habe durch die Überlassung des
Zeitarbeitnehmers an den Kunden und den dadurch hergestellten
Kontakt die Vermittlung überhaupt erst ermöglicht. Diese
Dienstleistung könne sich der Personaldienstleister ebenfalls
dann noch vergüten lassen, wenn der Begründung eines
Arbeitsverhältnisses zwischen dem Kunden und dem Zeitarbeitnehmer
eine arbeitgeberseitige Kündigung vorausgegangen sei. Auch der
Umstand, dass nach der Rechtsprechung des BGH bis zu sechs Monate
nach dem Ende der Überlassung vermutet werde, die Übernahme sei
auf die vorangegangene Überlassung zurückzuführen, spreche
dafür, dass der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Ende der
Überlassung und der anschließenden Einstellung bei der
Beurteilung einer solchen Klausel von Bedeutung sei, und weniger
die Frage, ob das Arbeitsverhältnis mit dem Personaldienstleister
zu diesem Zeitpunkt noch bestehe.
Diese
Ausführungen hielten – so der BGH – der rechtlichen
Nachprüfung stand. Das Berufungsgericht habe richtig gesehen,
dass die Klausel den vorliegenden Fall erfasse.
Bei
der Klausel zum Vermittlungshonorar handele es sich um eine von
der Rechtsvorgängerin der Klägerin gestellte AGB, deren Inhalt
durch Auslegung zu bestimmen sei. AGB seien nach ihrem objektiven
Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie von
verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der
Interessen der normalerweise beteiligten Kreise verstanden
würden. Dabei seien die Vorstellungen und
Verständnismöglichkeiten eines durchschnittlichen, rechtlich
nicht vorgebildeten Vertragspartners des Verwenders zugrunde zu
legen. Ansatzpunkt für die bei einer Formularklausel gebotene
objektive, nicht am Willen der konkreten Vertragspartner zu
orientierende Auslegung sei dabei in erster Linie ihr Wortlaut.
Verständnismöglichkeiten, die theoretisch denkbar, praktisch
aber fernliegend seien und nicht ernstlich in Betracht kämen,
blieben außer Betracht. Die Auslegung inländischer AGB sei in
der Revisionsinstanz uneingeschränkt nachprüfbar.
Nach
diesen Grundsätzen erstrecke sich die verwendete Klausel zum
Vermittlungshonorar
"Endet
das Arbeitsverhältnis des überlassenen Mitarbeiters mit der X
und begründet dieser anschließend ein Arbeitsverhältnis mit dem
Kunden oder einem mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen, […]"
auf
den Fall, dass das Arbeitsverhältnis durch eine Kündigung des
Personaldienstleisters "ende" (am 23.02.2015) und der
Mitarbeiter "anschließend" mit dem Kunden ein
Arbeitsverhältnis begründe (am 06.03.2015). Der Wortlaut der
Klausel unterscheide nicht danach, durch wen oder auf welche Weise
"das Arbeitsverhältnis des überlassenen Mitarbeiters mit
der X "(ge-)endet" (habe).
|