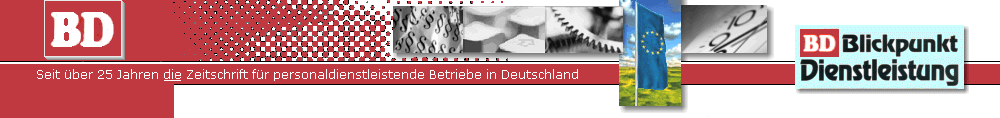|
Dr.
Alexander Bissels und Dr. Stefan Steeger
Zusammenführung
der Tarifverträge BAP/DGB und iGZ/DGB zu einem einheitlichen
Tarifwerk GVP/DGB – eine erläuternde Analyse (Teil 2)
Die
Zeitarbeitsbranche hat in den letzten Jahren eine signifikante
Entwicklung durchgemacht, die maßgeblich durch die
Zusammenführung der beiden Arbeitgeberverbände BAP und iGZ mit
Wirkung zum 01.12.2023 zum GVP geprägt wurde. Die von BAP und iGZ
mit der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit jeweils gesondert
vereinbarten Tarifwerke BAP/DGB und iGZ/DGB sind von der
"Fusion" nicht betroffen gewesen, sondern
"liefen" im GVP uneingeschränkt weiter. Damit ist nun
Schluss: mit Wirkung zum 01.01.2026 werden die beiden Tarifwerke
zu einem einheitlichen Regelwerk (GVP/DGB) zusammengefasst.
DAber
was steht nun konkret in dem neuen, ab dem 01.01.2026 geltenden
Tarifwerk GVP/DGB drin? Was ändert sich für die Tarifanwender?
Die Anpassungen möchten wir – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit – in unserem zweiten Teil der Aufsatzreihe
zusammenfassen. Der dritte und abschließende Teil folgt im
nächsten Heft.
Änderungen
im Manteltarifvertrag
Hinweis:
S. zu den Anpassungen im MTV GVP/DGB mit den Ziff. 1 bis 6:
Bissels/Steeger, BD 7/2025, S. 3 bis 8.
7.
Arbeitszeit
Die
individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit (bei Vollzeit)
beträgt in der neuen Tarifwelt 151,67 Stunden; dies entspricht im
Durchschnitt 35 Wochenarbeitsstunden (§ 3.1 Abs. 1 MTV GVP/DGB).
Mit
Blick auf die Arbeitszeitmodelle unterscheiden sich jedoch die
Tarifwerke BAP/DGB und iGZ/DGB. Im MTV iGZ/DGB ist – neben einer
verstetigten monatlichen Arbeitszeit (wie im MTV BAP/DGB) –
insbesondere noch ein variables Modell vorgesehen, das die
Arbeitszeit anhand der Arbeitstage in einem Monat festlegt (vgl.
§ 2 MTV BAP/ DGB; § 3.1. MTV iGZ/DGB). Das Letztgenannte fällt
zukünftig weg und wurde in den MTV GVP/DGB nicht übernommen,
allerdings ist eine großzügig bemessene Übergangsfrist für
bisherige iGZ-Anwender vorgesehen, die es ermöglicht, dieses
Arbeitszeitmodell bis zum 31.12.2029 (und damit noch vier Jahre
nach Inkrafttreten der neuen Tarifverträge) fortzuführen – im
Übrigen nicht nur bei Alt-Verträgen, sondern auch bei
Einstellungen, die ab dem 01.01.2026 erfolgen werden.
Das
Zeitarbeitsunternehmen (bisheriger iGZ-Anwender) ist berechtigt,
in der Zeit bis zum 31.12.2029 einmalig von dem variablen in das
verstetigte Modell zu wechseln. Dies kann durch eine einseitige
Erklärung des Arbeitgebers geschehen; die Zustimmung des
Zeitarbeitnehmers ist dafür nicht erforderlich. Sollte bis zum
31.12.2029 kein aktiver Wechsel erfolgt sein und die
Übergangsregelung auslaufen, besteht keine hinreichende
(tarifliche) Legitimation für die Fortführung des variablen
Arbeitszeitmodells. Diese wäre tarifwidrig und stellt eine
Abweichung von den tariflichen Bestimmungen dar.
Ob
eine automatische Überführung in das verstetigte
Arbeitszeitmodell mit Ablauf des 31.12.2029 stattfindet, dürfte
streitbar sein. Auf der einen Seite läuft die Übergangsregelung
aus und verliert damit ihre Wirksamkeit, so dass argumentiert
werden könnte, dass als „Auffanglösung“ das Modell mit einer
verstetigten Arbeitszeit zur Anwendung kommen muss. Auf der
anderen Seite kann dagegen angeführt werden, dass – zumindest
bei einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelung –
weiterhin ein rechtsverbindlicher Tatbestand die Geltung der
variablen Arbeitszeit anordnet, der auch nicht (zumindest nicht
zwingend) mit dem Auslaufen der Übergangsregelung außer Kraft
tritt, sondern den 31.12.2029 überdauert und als konstitutiver
Rechtsakt (gegen die tariflichen Bestimmungen) das Modell mit
variabler Arbeitszeit „fortschreibt“.
Vor
diesem Hintergrund ist Zeitarbeitsunternehmen anzuraten, die
Übergangsfrist ernst zu nehmen (insbesondere um sich
entsprechende Diskussionen mit der BA und den Zeitarbeitnehmern zu
ersparen) und zu einem Stichtag vor dem 31.12.2029 sämtliche
Arbeitsverhältnisse aktiv auf das verstetigte Arbeitszeitmodell
„umzustellen“. Im Zweifel kann ein Zustand eintreten, dass bei
einem Zeitarbeitsunternehmen die variable Arbeitszeit (für sog.
Alt-Arbeitnehmer) und das verstetigte Modell (für
Neueinstellungen) nebeneinander zur Anwendung kommen; ein solcher
Zustand sollte jedoch aus praktischer Sicht vermieden werden
(organisatorisch aufwendig, hohe Fehleranfälligkeit bei der
Abwicklung etc.). Empfehlenswert dürfte sein, dass das
Zeitarbeitsunternehmen die Umstellung des Arbeitszeitmodells mit
einem hinreichenden zeitlichen Vorlauf plant und dieses dann
einheitlich für Alt- und Neu-Arbeitnehmer implementiert.
Bisherigen
BAP-Anwendern ist es im Übrigen verwehrt, ihrerseits auf das
variable Arbeitszeitmodell aus dem MTV iGZ/DGB „umzuschwenken“;
diese können mit Blick auf die eingrenzenden tariflichen
Bestimmungen – wie bisher – „nur“ eine verstetigte
Arbeitszeit mit den Zeitarbeitnehmern vereinbaren.
Die
in den Tarifwerken BAP/DGB und iGZ/DGB vorgesehene Möglichkeit,
die monatliche Arbeitszeit von 151,67 Stunden auf bis zu 174,34
Stunden im Monat zu erhöhen, findet sich inhaltsgleich im MTV GVP/DGB
wieder (dort: § 3.1 Abs. 2). Die (bisherige) Protokollnotiz, nach
der trotz der Erhöhung der Arbeitszeit nicht ausgeschlossen ist,
dass Zeitarbeitnehmer ausnahmsweise kurzfristig in einem Betrieb
eingesetzt werden, dessen betriebliche Arbeitszeit niedriger ist
als die arbeitsvertraglich vereinbarte, ist direkt in den
Tariftext übernommen worden (§ 3.1 Abs. 3 MTV GVP/ DGB).
Die
Definition der Teilzeittätigkeit (§ 3.2. MTV GVP/DGB) ist
wörtlich aus § 3.1.1. Abs. 2 MTV iGZ/DGB übernommen worden,
ohne dass dies inhaltliche Auswirkungen auf bisherige BAP-Anwender
hat, die zumindest eine inhaltlich entsprechende Regelung kennen
(§ 3 MTV BAP/ DGB).
Die
faktische Anpassung der Arbeitszeit des Zeitarbeitnehmers an
diejenige des Kunden wird in § 3.3 MTV GVP/DGB geregelt. Dabei
hat man sich der Formulierung des MTV BAP/DGB bedient (dort: §
4.1 Abs. 1), ohne dass dies eine inhaltliche Abweichung zur
Bestimmung im MTV iGZ/DGB (dort: § 3.1.3.) bedeuten würde.
Die
Regelung zu Rüstzeiten, die nicht als Arbeitszeit zu
qualifizieren sind, wenn im Kundenbetrieb keine abweichenden
Regelungen gelten (§ 3.4 MTV GVP/DGB), stammt aus dem MTV BAP/DGB
(dort: § 4.1 Abs. 2). Eine vergleichbare Bestimmung fehlt im MTV
iGZ/DGB.
Die
Klausel zum Einsatz in Schichtmodellen (§ 3.5 MTV GVP/DGB) wurde
aus dem MTV iGZ/DGB übernommen (dort: § 3.1.4.). Aus dem MTV
iGZ/DGB wurde zudem die Regelung überführt, dass Heiligabend und
Silvester vom Zeitarbeitsunternehmen (einseitig) mit Urlaub oder
Plusstunden aus dem AZK belegt werden können (§ 3.1.5. S. 3 MTV
iGZ/DGB; § 3.6 S. 2 MTV GVP/DGB). Inhaltlich vergleichbare
Regelungen sind im MTV BAP/DGB nicht enthalten.
Der
jährliche Bezugspunkt im MTV BAP/DGB zur Bestimmung, ob die
vereinbarte individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit
erreicht wird, entfällt (dort: § 2 Abs. 1 S. 2, Abs. 3). Ein
Jahresbezug (mit insgesamt 1.820 Stunden) ist im MTV GVP/ DGB
nicht mehr vorgesehen.
ACHTUNG:
Die Anpassungen bei der Arbeitszeit betreffen im Wesentlichen die
bisherigen iGZ-Anwender. Die Auswirkungen dürften nicht
unerheblich sein, allerdings wurde mit der großzügig bemessenen
Übergangsfrist eine Regelung geschaffen, die es den
Zeitarbeitsunternehmen ermöglicht, mit entsprechender Vorlauf-
und Vorbereitungszeit den Schritt in die verstetigte Arbeitszeit
umzusetzen und zu vollziehen. Man sollte sich nur „rechtzeitig“
mit diesem Thema befassen und die erforderlichen
Anpassungsschritte angehen.
8.
Arbeitszeitkonto
Die
Regelungen zu einem AZK, das für Zeitarbeitnehmer nach beiden
Tarifwerken grundsätzlich verpflichtend zu errichten und zu
führen ist, unterscheiden sich inhaltlich – mitunter nicht
unerheblich (§ 4 MTV BAP/DGB; § 3.2. MTV iGZ/DGB).
Bei
der Zusammenführung der Bestimmungen zum AZK im MTV GVP/DGB hat
man sich an den Regelungen des MTV BAP/DGB orientiert (s. dort: §
4), das – aus Sicht der Praxis – im Ergebnis das flexiblere
Modell darstellt und an dessen Vorzügen zukünftig auch bisherige
iGZ-Nutzer partizipieren können. Für beide Tarifanwender sind
die neuen Bestimmungen mit Änderungen verbunden, wobei sich der
Anpassungsbedarf bei den bisherigen iGZ-Nutzern „eingriffsintensiver“
darstellt.
Die
wesentlichen Modifikationen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
-
Die Obergrenze für Plusstunden im AZK beträgt bei einer
Vollzeittätigkeit maximal 200 Stunden (bisher nach MTV iGZ/ DGB:
150 Stunden); bei saisonalen Schwankungen kann die Obergrenze zur
Beschäftigungssicherung auf 230 Stunden erhöht werden. Bei
Teilzeitkräften wird die Obergrenze im Verhältnis zur
vereinbarten Arbeitszeit nach unten angepasst. (...)
|