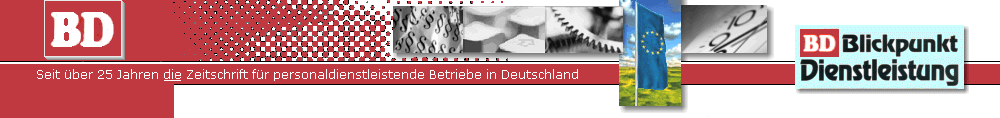|
Dr.
Robert Bauer
Das
BAG, der EuGH und der „Men in Black“-Effekt
Sie
müssen nicht Googlen, den Begriff des „Men in Black“ Effekts
habe ich mir ausgedacht. Er ist angelehnt an den Film aus den 90er
Jahren und beschreibt den Effekt, dass – wenn alles klappt –
die betroffenen Personen sich nicht bewusst sind, wie knapp sie
einer Katastrophe entkommen sind.
Vor
über sechs Jahren startete mit der sogenannten
„Däubler-Kampagne“ der Versuch, gerichtlich feststellen zu
lassen, dass durch die deutschen Zeitarbeitstarifverträge iGZ und
BAP nicht wirksam vom Gleichstellungsgrundsatz abgewichen werden
könne. Die EU-Zeitarbeitsrichtlinie erlaube es nicht, dass
pauschal eine finanzielle Schlechterstellung im Vergleich zu der
Stammbelegschaft des Entleihunternehmens erfolge. Demnach sei
sowohl die gesetzliche Regelung hierzu im AÜG, als auch die
Umsetzung durch die Tarifverträge unwirksam. Viele dieser
Verfahren sind unterwegs aus verschiedensten Gründen gescheitert.
Im Dezember 2020 schafften es aber tatsächlich drei dieser
Verfahren bis zum BAG (vgl. den Beitrag hierzu in der Ausgabe
Januar 2021). Zwei dieser Verfahren wurden dort aus formalen
Gründen zurückgewiesen, das Dritte stand aber tatsächlich zur
Entscheidung an.
Das
BAG ist dabei zwar das höchste deutsche Arbeitsgericht, konnte
den Fall aber gleichwohl nicht allein entscheiden, da die
Auslegung europäischer Vorschriften entscheidungserheblich war.
Konkret ging es darum, welche Anforderungen eine nationale
Regelung erfüllen muss, um den vorgeschriebenen „Gesamtschutz
der Zeitarbeitnehmer“ zu wahren. Diese Frage wurden demnach dem
EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Die Antwort des EuGH kam am 15.
Dezember 2022 und bot durchaus Grund zur Sorge.
So
wurde zwar recht deutlich, dass die gesetzliche Regelung zur
Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz grundsätzlich nicht dem
Europarecht widerspricht. Allerdings wurden Anforderungen an die
Regelungen in den Tarifverträgen formuliert. So müssen
nachteilige Abweichungen vom Equal Treatment Niveau in den
Tarifverträgen durch vorteilhafte Abweichungen ausgeglichen
werden. Der Vergleich muss dabei individuell für den jeweiligen
Arbeitsplatz erfolgen.
Und genau diese Anforderungen waren der Knackpunkt. Wie so vieles
in der Juristerei kann man auch diese Vorgaben auf
unterschiedliche Art und Weise auslegen. Um die Frage, was die
korrekte Auslegung ist, wurde im Mai diesen Jahres vor dem BAG
erbittert gekämpft.
Denkbar
– und von der Klägerin vertreten – wäre eine Auslegung,
wonach die Tarifverträge beispielsweise nur dann ein geringeres
Weihnachtsgeld als der Entleiher vorsehen dürften, wenn dafür im
Gegenzug das Urlaubsgeld höher ausfällt. Und für jeden vollen
Euro Stundenlohnabweichung müsste beispielsweise ein Urlaubstag
zusätzlich gewährt werden, etc. Ganz abgesehen von dem
offensichtlichen Punkt, dass die Tarifverträge derzeit nicht
derart kleinteilige „Vergleichsberechnungen“ vorsehen, wäre
sehr fraglich, ob eine solche Ausgleichssystematik überhaupt
abstrakt in einem Tarifvertrag formulierbar wäre. Diese
Auslegungsvariante hätte demnach zu dem Ergebnis geführt, dass
mit den aktuellen Tarifverträgen (rückwirkend!) nicht vom
Gleichbehandlungsgrundsatz hätte abgewichen werden können.
Anders als bei der unsäglichen CGZPThematik hätte es dieses Mal
jedoch keine alternativen Tarifverträge gegeben, auf die man sein
Geschäftsmodell hätte umstellen können. Die Zeitarbeitsbranche
hätte sich demnach potentiellen Lohnnachforderungen der
Zeitarbeitnehmer und Beitragsnachforderungen der Deutschen
Rentenversicherung für die letzten Jahre ausgesetzt gesehen und
hätte parallel dazu ihr Geschäftsmodell von jetzt auf gleich auf
das gesetzliche Equal Treatment Prinzip umstellen müssen.
|