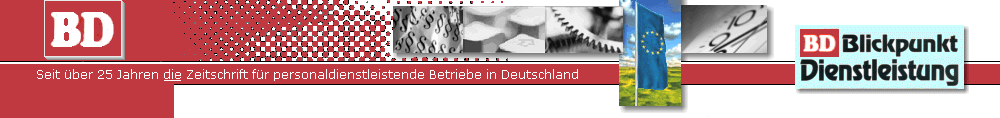|
Dr.
Alexander Bissels und Dr. Jonas Singraven
Das
sog. Gesamtschutzverfahren des BAG: Die vollständig abgesetzten
Gründe liegen (endlich) vor!
Die
Katze ist bereits seit dem 31.05.2023 aus dem Sack! Das BAG hat
festgestellt, dass die Tarifwerke der Zeitarbeit die
europarechtlichen Vorgaben erfüllen und folglich eine wirksame
Grundlage darstellen, um vom Gleichstellungsgrundsatz
(hinsichtlich des Entgelts) abweichen zu können. Der 5. Senat
fasst das Ergebnis des sog. „Gesamtschutzverfahrens“ wie folgt
zusammen (Az. 5 AZR 143/19):
„Das
vom Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen mit der
Gewerkschaft ver.di geschlossene Tarifwerk zur Leiharbeit, das vom
Grundsatz des gleichen Arbeitsentgelts (§ 8 Abs. 1 S. 1 AÜG bzw.
§ 10 Abs. 4 S. 1 AÜG a.F.) "nach unten" abweicht,
genügt den unionsrechtlichen Anforderungen des Art. 5 Abs. 3
Richtlinie 2008/104/EG.“
Im
Vorfeld zu der Entscheidung waren zahlreiche Stimmen zu vernehmen,
die einen abweichenden Ausgang – aus Branchensicht – im
negativen Sinne erwartet oder prognostiziert haben. Vor diesem
Hintergrund war das Aufatmen der Zeitarbeitsunternehmen bereits am
31.05.2023 deutlich zu vernehmen. Auch wenn sich die wesentlichen
Grundzüge und Erwägungen, die das BAG der Entscheidung zugrunde
gelegt hat, schon aus der bereits am 31.05.2023 veröffentlichen
Pressemitteilung entnehmen ließen, durfte man auf die
vollständig abgesetzten Gründe des Urteils, gerade mit Blick auf
befristet auf den Einsatz synchronisiert abgeschlossene
Arbeitsverhältnisse, gespannt sein. Diese liegen nun seit Mitte
September 2023 vor.
I.
Zusammenfassung der Entscheidung
Die Begründung des 5. Senats lässt sich dabei wie folgt
zusammenfassen:
Die
Klägerin war aufgrund eines für die Zeit vom 04.04.2016 bis zum
04.04.2017 befristeten Arbeitsvertrags bei dem beklagten
Personaldienstleister als Zeitarbeitnehmerin beschäftigt. Sie
erhielt im Januar und Februar 2017 einen Stundenlohn von 9,00 EUR
brutto, in den Folgemonaten von 9,23 EUR brutto. Die Klägerin ist
Mitglied von ver.di, die Beklagte gehört dem iGZ an.
Nachdem
die Klägerin von der Beklagten eine weitere Vergütung für den
Zeitraum Januar bis April 2017 erfolglos gefordert hatte, klage
sie auf Zahlung einer Differenz in Höhe von 1.296,72 Euro brutto
und behauptet, vergleichbare Stammarbeitnehmer der Entleiherin
seien nach dem Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer
im Einzelhandel in Bayern vergütet worden und hätten im
Streitzeitraum eine – vom tariflichen Monatslohn
heruntergerechnete – Stundenvergütung von 13,64 EUR brutto
erhalten. Sie meint, die Tariföffnung im AÜG sowie die auf ihr
Arbeitsverhältnis Anwendung findenden Tarifverträge seien mit
Art. 5 Abs. 3 der Zeitarbeitsrichtlinie vom 19.11.2008
(nachfolgend kurz: RiLi) nicht vereinbar, weil sie den
Gesamtschutz von Zeitarbeitnehmern nicht ausreichend achteten.
Dieser
Ansicht folgten weder das ArbG Würzburg noch das LAG Nürnberg.
Das BAG legte den Fall zunächst dem EuGH vor (Beschl. v.
16.12.2020 – 5 AZR 143/19 (A) und hat diesen um die Beantwortung
mehrerer Rechtsfragen zur Auslegung und Anwendung von Art. 5 Abs.
3 RiLi und zu der dort verlangten, aber nicht näher definierten
„Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ ersucht.
Auf Grundlage der Entscheidung des EuGH vom 15.12.2022 (Rs. C-
311/21) wies das BAG schließlich die von der Klägerin eingelegte
Revision zurück und bestätigte damit die Urteile der
Instanzgerichte.
Die
Klägerin habe keinen Anspruch auf eine weitere Vergütung unter
dem Gesichtspunkt der Gleichstellung. Die Beklagte sei nur zur
Zahlung des tariflichen Arbeitsentgelts verpflichtet. Für das
Arbeitsverhältnis gölten kraft der beiderseitigen
Tarifgebundenheit die von iGZ und ver.di für die
Zeitarbeitsbranche geschlossenen Tarifverträge, die vom
Gleichstellungsgrundsatz abwichen. Diese seien nach nationalem
Tarifrecht wirksam und unterschritten nicht die in einer
Rechtsverordnung nach § 3a Abs. 2 AÜG festgesetzten
Mindeststundenentgelte oder den im Streitzeitraum geltenden
gesetzlichen Mindestlohn.
Zunächst
sei die Klägerin nach allgemeinen Grundsätzen zur Höhe des
Anspruchs auf gleiches Arbeitsentgelt darlegungs- und
beweispflichtig. Treffe deren (von der Beklagten bestrittene)
Behauptung zur Vergütung vergleichbarer Stammarbeitnehmer zu,
weiche das Tarifwerk von iGZ und ver.di im Hinblick auf die
streitgegenständliche wesentliche Arbeits- und
Beschäftigungsbedingung „Arbeitsentgelt“ vom Grundsatz der
Gleichstellung ab.
Der
nationale Gesetzgeber sei bei der Zulassung von Abweichungen vom
Gleichstellungsgrundsatz durch Tarifvertrag davon ausgegangen,
dass nach deutschem Arbeitsrecht Tarifverträgen grundsätzlich
eine Richtigkeitsgewähr zukomme. Zudem stehe den
Tarifvertragsparteien aufgrund der durch Art. 9 Abs. 3 GG
geschützten Tarifautonomie ein weiter Gestaltungsspielraum zu.
Sie hätten außerdem eine Einschätzungsprärogative, soweit die
tatsächlichen Gegebenheiten, die betroffenen Interessen und die
Regelungsfolgen zu beurteilen seien. Darüber hinaus verfügten
sie über einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der
inhaltlichen Gestaltung der tariflichen Bestimmungen. Durch die
hohen Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Tariffähigkeit
einer Gewerkschaft stelle, sei jedenfalls seit dem CGZPBeschluss
des BAG vom 14.12.2010 (Az. 1 ABR 19/10) außerdem ein Missbrauch
der Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz durch Tarifvertrag mit
Hilfe arbeitgebernaher „Arbeitnehmervereinigungen“ praktisch
ausgeschlossen. Die Personaldienstleister seien vielmehr für
Abweichungen vom Gleichstellungsgrundsatz auf die
DGB-Gewerkschaften, wie ver.di, geradezu angewiesen. Gleichwohl
sei der 5. Senat nach den Vorgaben des EuGH gehalten, bei einer
Abweichung vom Grundsatz der Gleichstellung durch Tarifvertrag
uneingeschränkt zu überprüfen, ob das entsprechende Tarifwerk
den Gesamtschutz der Zeitarbeitnehmer angemessen achte, und
verpflichtet, die Vereinbarkeit der tariflichen Abweichung vom
Gleichstellungsgrundsatz mit den sich aus Art. 5 Abs. 3 RiLi
ergebenden Anforderungen sicherzustellen. Zwar verfügten die
Sozialpartner bei der Aushandlung und dem Abschluss von
Tarifverträgen nach Unionsrecht (Art. 28 GRC) über einen weiten
Beurteilungsspielraum; die RL wolle nach ihrem Erwägungsgrund 19
die Autonomie der Sozialpartner auch nicht beeinträchtigen. Doch
müsse – so der EuGH – das Recht auf Kollektivverhandlungen im
Rahmen der Anwendung des Unionsrechts im Einklang mit diesem
ausgeübt werden. Das auf das Arbeitsverhältnis der Parteien
Anwendung findende, von iGZ und ver.di geschlossene Tarifwerk
genüge – jedenfalls hinsichtlich der streitgegenständlichen
wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingung
„Arbeitsentgelt“ – den Anforderungen nach Art. 5 Abs. 3 RiLi.
Ein von der Vergütung vergleichbarer Stammarbeitnehmer
unabhängiges, im Regelfall niedrigeres tarifliches Arbeitsentgelt
achte im Zusammenspiel mit den gesetzlichen Vorgaben zum Schutz
der Zeitarbeitnehmer deren Gesamtschutz.
Den
Sachvortrag der Klägerin zu ihren Gunsten als wahr unterstellt,
habe sie im Hinblick auf ihr Arbeitsentgelt einen Nachteil
erlitten, weil sie mit der tariflichen Vergütung ein geringeres
Entgelt erhalten habe, als sie bekommen hätte, wenn sie von der
Entleiherin unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz eingestellt
worden wäre. Eine solche Schlechterstellung lasse aber Art. 5
Abs. 3 RiLi ausdrücklich zu, sofern dies unter „Achtung des
Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ erfolge. Um diesen zu
gewährleisten, sollten nach den Vorgaben des EuGH
Ausgleichsvorteile eine Neutralisierung der Ungleichbehandlung
bezwecken bzw. es ermöglichen, die Auswirkungen der
Ungleichbehandlung auszugleichen. Die Sozialpartner dürften sich
danach nicht darauf beschränken, eine oder mehrere der in Art. 3
Abs. 1 lit. f) RiLi definierten wesentlichen Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen zu verschlechtern. Nicht verlangt habe
der EuGH indes, dass auf die wesentlichen Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen bezogene Ausgleichsvorteile in summa
gleichsam wieder zur Gleichstellung führen müssten. Auch
verlange der EuGH nicht zwingend, dass der zur Achtung des
Gesamtschutzes erforderliche Ausgleich ausschließlich durch den
Tarifvertrag selbst erfolgen müsse. An keiner Stelle seiner
Entscheidung formuliere der EuGH, dass – so das BAG – der
erforderliche Ausgleich einer Ungleichbehandlung nicht auch durch
zwingende gesetzliche Regelungen erfolgen könne. Das sei
konsequent, weil die RiLi mit deren Art. 5 Abs. 2 bis Abs. 4 dem
Umstand Rechnung trage, dass die Regulierung von Zeitarbeit und
der Schutz der Zeitarbeitnehmer innerhalb der EU höchst
unterschiedlich ausgestaltet seien. In Art. 5 Abs. 3 RiLi
berücksichtige sie Rechtsordnungen, in denen dies im Wesentlichen
durch Kollektivverträge erfolge. Dem Anliegen der skandinavischen
Länder, ihr Modell unter der RiLi beizubehalten, entspreche die
Aufnahme der Gestaltungsmöglichkeit in Art. 5 Abs. 3 RiLi. Da
diese unionsweit einheitlich gelte, würden hierdurch indessen
gesetzliche Ausgleichsregelungen in einzelnen Mitgliedstaaten
nicht ausgeschlossen. Ein derartiges Verständnis sei dem Urteil
des EuGH nicht zu entnehmen.
Soweit
der EuGH davon spreche, befristet beschäftigten Zeitarbeitnehmern
müsse „ein erheblicher ausgleichender Vorteil“ gewährt
werden, füge er selbst (relativierend) hinzu, dass dieser „im
Wesentlichen mindestens das gleiche Niveau haben muss wie der, der (...)
|